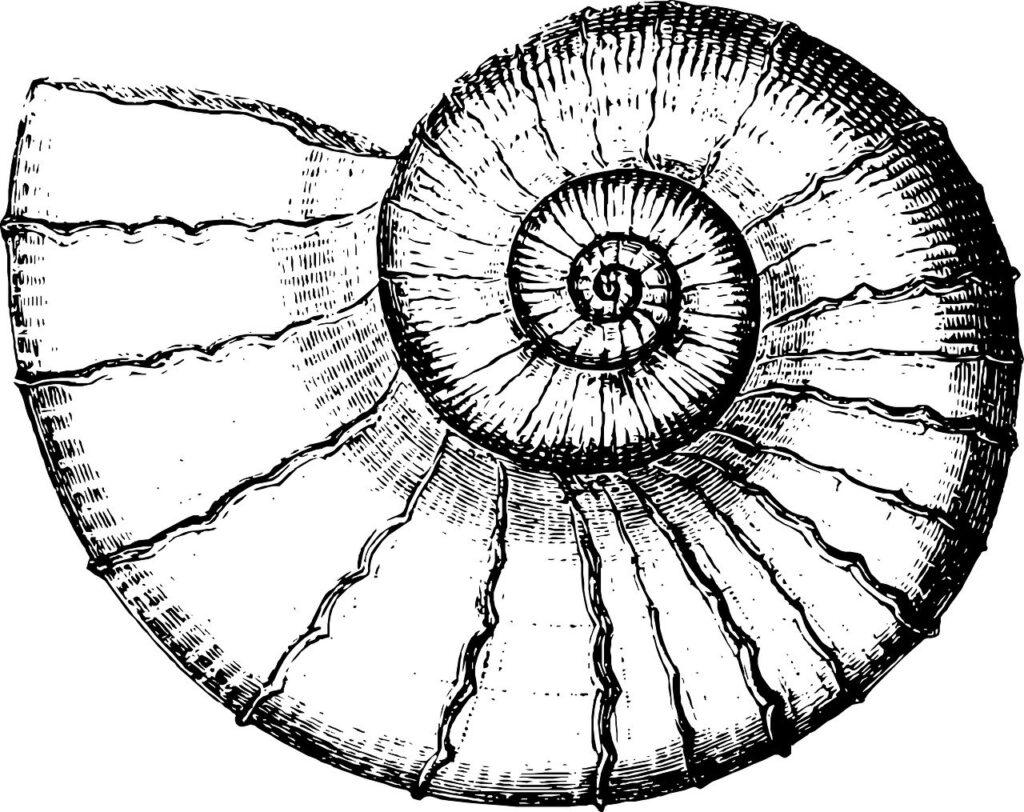Auftakt zur Reihe „Zyklisches Denken“
Als ich meine Idee zum ersten Mal einem Kollegen erzählte, sah er sehr interessiert aus – aber er rührte einen Tick zu lange in seinem Kaffee. Und vielleicht juckte ihn wirklich etwas an der linken Augenbraue. Aber irgendwie wurde ich den Verdacht nicht los, dass er das Ganze nicht besonders plausibel fand.
Jedenfalls fragte er mich irgendwann, ob ich dafür eigentlich mal ein praktisches Beispiel habe. Hatte ich nicht. War doof. Merkte ich selbst.
Das war vor zwei Jahren – und ich bin immer noch von meiner Idee überzeugt. Inzwischen habe ich auch meine Hausaufgaben gemacht: Ich habe nach Beispielen gesucht – und welche gefunden. Und mit denen wage ich mich nun zum zweiten Mal mit meiner Idee nach vorne.
Als Agile Coach und Wildnisführer bin ich in zwei Welten unterwegs, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Die eine Welt erzählt von New Work, von Agilität, Digitalisierung und Innovation. Sie gilt als Avantgarde der Wissensgesellschaft.
Die andere Welt erzählt von Holzrauch und Stiefelfett, von tiefen, rauschenden Wäldern und vom Sternenhimmel einer kristallklaren Winternacht. Sie gilt als archaische Romantik.
Jedenfalls scheint das von außen so auszusehen; ich werde nämlich ziemlich oft gefragt, wie ich denn diesen Spagat eigentlich hinkriege und ob das eine ein Ausgleich für das jeweils andere sei. Ist es nicht. Und ich empfinde es auch immer weniger als Spagat.
Unsere Arbeitswelt wird heute gemeinhin als „VUCA“ wahrgenommen. Dieser Kunstbegriff steht für volatil, unsicher, chaotisch und vieldeutig (Ambiguität). Okay, ich kürze das mal ab und nenne es „komplex“. Bekanntlich helfen im komplexen Umfeld keine detaillierten Pläne (die sind nützlich in komplizierten Umfeldern), sondern eine iterative und inkrementelle Vorgehensweise – heißt: Sich in kleinen Schritten, die aufeinander aufbauen, einer möglichst brauchbaren Lösung anzunähern. Das nennt man Agiles Arbeiten.
Ob ich damit Software entwickle, einen Transformationsprozess steure und begleite, mit dem Seekajak durch die Schären kreuze oder auf Schneeschuhen durchs alpine Gelände wandere: Das Umfeld ist in allen Fällen komplex, nur die konkreten Bedingungen sind unterschiedlich (ziemlich unterschiedlich sogar).
Allerdings hatte ich schon seit geraumer Zeit die Natur im Verdacht, die Prinzipien der Selbstorganisation deutlich besser zu beherrschen als der Mensch. Außerdem verfügen natürliche Systeme über ein hohes Maß an Intelligenz, um sich selbst zu erhalten.
Das erlebe ich gerade vor meiner Haustür im Schwarzwald: Die Fichten dort haben ziemlich flache Wurzeln und mögen es am liebsten feucht und kühl. Das letzte Jahr und dieser Frühling haben ihnen stattdessen Trockenheit, Hitze und starke Stürme beschert. Erst kam der Borkenkäfer und dann der Wind – nun sind ganze Hänge kahl, die vor kurzem noch bewaldet waren. Trotzdem: Der Wald ist nicht verschwunden! Im schützenden Schatten der gestürzten Fichten wachsen plötzlich überall kleine Eichen aus der Erde. Ich habe keine Ahnung, woher die plötzlich alle kommen. Auf jeden Fall sorgt das Ökosystem Wald für seinen Fortbestand, und zwar auf eine ziemlich intelligente Weise. Eichen werden vom Borkenkäfer nicht angegriffen. Sie haben sehr tiefe Wurzeln und kommen mit Wärme und Trockenheit problemlos klar.
Nun bin ich zwar Wildnisführer und viel in der Natur unterwegs, aber trotzdem lerne ich jeden Tag dazu, wenn ich das Haus verlasse. Es ist einfach unfassbar, wie viele kreative Lösungsmuster und -strukturen die Natur zu bieten hat. Wenn wir sie aufmerksam beobachten, können wir ihre Strategien erlernen und zur Bewältigung unserer eigenen Herausforderungen nutzen.
Aber eigentlich wollte ich ja von meiner Idee erzählen. Die ist ganz einfach:
Neulich, vor ein paar Tausend Jahren, waren wir eine Jäger- und Sammlergesellschaft – heute sind wir eine Wissensgesellschaft. Damals waren unsere Probleme eher physischer Natur – heute sind sie eher geistiger Natur. Die Kernfrage ist aber nach so vielen Tausend Jahren die gleiche: Wie können wir in einem komplexen Umfeld unser Zusammenleben bzw. -arbeiten effektiv organisieren?
Ich finde die Idee ziemlich nahe liegend, dass auch unsere Vorfahren die Lösungsmuster und -strukturen der Natur beobachtet und für die Organisation ihrer Gemeinschaften genutzt haben. Jedenfalls muss es ihnen irgendwie gelungen sein, im komplexen Umfeld handlungsfähig zu werden und sich weiterzuentwickeln.
Was hat nun Praxiswissen aus der Steinzeit mit moderner Organisationsentwicklung zu tun? Hat das uralte Wissen von damals auch heute noch praktische Relevanz?
Um diese Fragen zu klären, ist möglicherweise ein kurzer Ausflug in die Entwicklungspsychologie nützlich. Dort wird unter anderem mit Modellen wie Spiral Dynamics gearbeitet, demzufolge menschliche Entwicklung nicht linear verläuft, sondern in Form einer nach oben offenen Spirale. Das heißt: An jedem beliebigen Punkt auf dieser „Entwicklungsspirale“ sind wir mit Herausforderungen konfrontiert, denen wir schon mal begegnet sind – nur unter anderen Bedingungen. Es ist durchaus legitim, hier auf dem Wissen und den Erfahrungen der Vergangenheit aufzubauen und diese auf die gegenwärtigen Bedingungen anzupassen. Folglich ist das uralte Wissen durchaus relevant, aber nützlich kann es nur werden, wenn wir es für die geänderten Bedingungen „übersetzen“. Ansonsten hätten wir es mit einer Art „Steinzeitfundamentalismus“ zu tun.
Wo genau ist jetzt die Idee? Entwicklung baut doch immer auf bereits vorhandenem Wissen auf?!
Tatsächlich ist das nicht zwangsläufig der Fall. Es gab in der Geschichte der Menschheit immer wieder Paradigmenwechsel und auch Innovationen, die so stark waren, dass sie unsere Lebensbedingungen ganz grundlegend veränderten. Dies führte zu einer Entwicklung, in deren Verlauf sich das unmittelbar zuvor gültige Wissen als wenig nützlich herausstellte und deshalb als „veraltet“ abgestempelt wurde.
Beispiele für solche bekannten Paradigmenwechsel sind die Digitalisierung, die Industrialisierung oder der Buchdruck. Allerdings gibt es auch sehr subtile Paradigmenwechsel in der Geschichte der Menschheit, die uns möglicherweise gar nicht mehr bewusst sind (oder nie waren). Ein solcher Wechsel ist zum Beispiel die Veränderung unseres Denkens.
Um es mal grob vereinfacht auszudrücken: In der Wissensgesellschaft denken wir linear (in Ursache-Wirkungsbeziehungen) – unsere Vorfahren in der Jäger- und Sammlergesellschaft dachten zyklisch (in Kreislaufbeziehungen). Das ist ein ganz zentraler Aspekt, denn bekanntlich führen unterschiedliche Denkweisen zu unterschiedlichen Lösungsansätzen. Dazu liefern uns Ethnologie, Anthropologie, Kulturwissenschaften und weitere Disziplinen ein ziemlich eindrucksvolles Bild: Zyklisches Denken ermöglichte über verschiedene Kulturkreise, Kontinente und Zeitalter hinweg Formen des Zusammenlebens, die von großer sozialer und ökologischer Stabilität geprägt waren.
Wir Menschen waren also schon ziemlich früh in der Lage, mit komplexen Umfeldern umzugehen. Offenbar sind uns diese Fähigkeiten abhanden gekommen. Wenn Organisationen sich heute mit Agilität und ganzheitlichen Modellen auseinandersetzen, sieht das jedenfalls meist nicht gerade so aus, als würden sie altbekanntes Wissen wieder entdecken.
Genau an diesem Punkt möchte ich ansetzen, wenn ich in den kommenden Wochen und Monaten immer wieder Artikel veröffentliche, in denen vom zyklischen Denken die Rede ist:
Ich möchte verschiedene Modelle und Methoden vorstellen, ihre Herkunft und Verbreitung schildern und aufzeigen, wie eine Übersetzung dieses uralten Wissens auf die Bewusstseinsebene unserer heutigen Wissensgesellschaft aussehen könnte (wenn möglich an einem Praxisbeispiel).